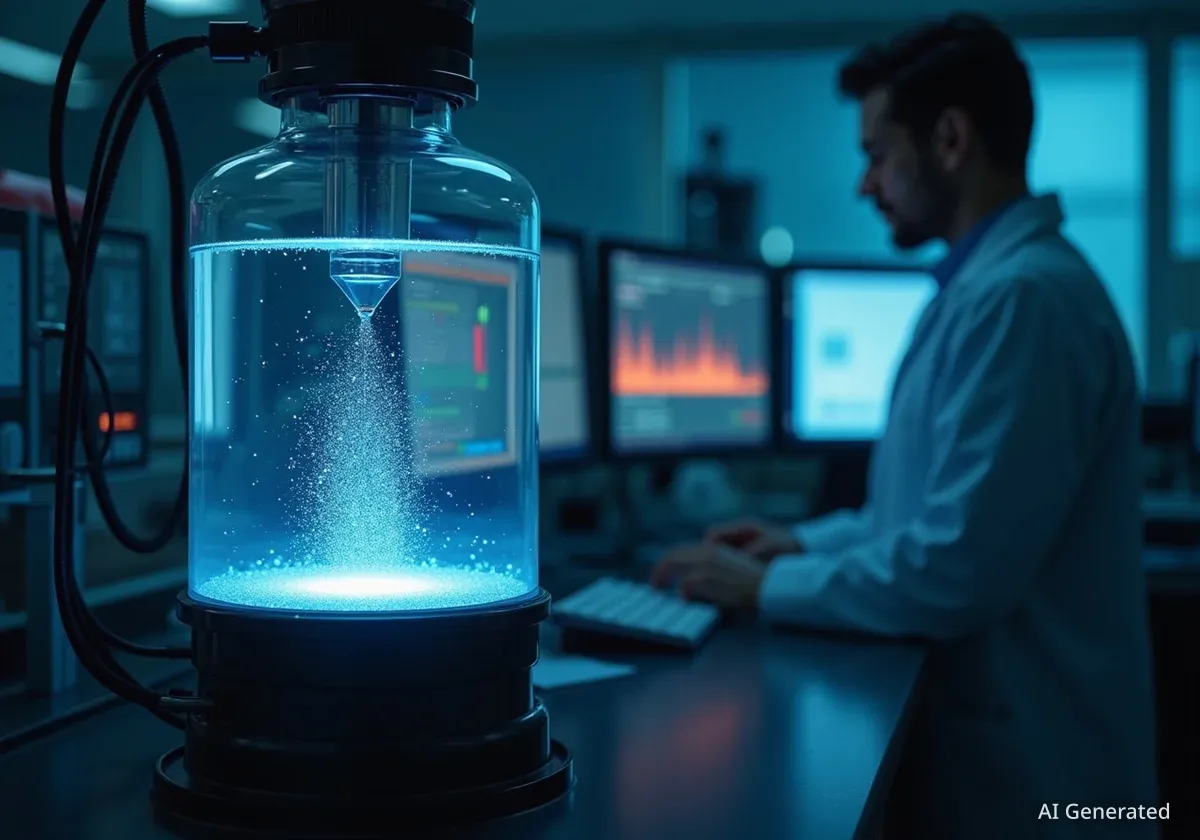Das Rennen um leistungsfähige Quantencomputer wird von etablierten Technologien dominiert. Doch ein Unternehmen namens EeroQ verfolgt einen neuen Ansatz, der auf seit Jahrzehnten bekannter Physik basiert: einzelne Elektronen, die über einer Oberfläche aus flüssigem Helium schweben. In einer neuen Studie demonstriert das Team, wie sie diese Elektronen präzise einfangen und kontrollieren können – der erste entscheidende Schritt zur Realisierung eines neuartigen Qubits.
Diese Methode verspricht, einige der größten Hürden bei der Skalierung von Quantencomputern zu überwinden. Insbesondere die erwartete hohe Stabilität der Qubits und die Möglichkeit, Chips mit Standardverfahren zu fertigen, könnten der Technologie einen entscheidenden Vorteil verschaffen.
Wichtige Erkenntnisse
- Das Unternehmen EeroQ entwickelt eine neue Qubit-Technologie, die auf Elektronen basiert, die über flüssigem Helium schweben.
- Die Methode nutzt ein 50 Jahre altes physikalisches Prinzip, bei dem ein Elektron an sein eigenes „Spiegelbild“ in der dielektrischen Helium-Flüssigkeit gebunden wird.
- Forschern gelang es, einzelne Elektronen auf einem Siliziumchip gezielt einzufangen und ihre Anwesenheit zu messen.
- Der Ansatz verspricht eine außergewöhnlich hohe Kohärenz (Stabilität) der Qubits und ermöglicht die Herstellung von Chips mit etablierter CMOS-Technologie, was die Skalierung erleichtern könnte.
Die Physik hinter dem schwebenden Elektron
Obwohl der Wettlauf um den Quantencomputer oft wie eine Domäne modernster Physik wirkt, greift der Ansatz von EeroQ auf ein gut verstandenes Phänomen zurück. Die Idee, ein Elektron über flüssigem Helium schweben zu lassen, wurde bereits vor einem halben Jahrhundert demonstriert.
Johannes Pollanen, wissenschaftlicher Leiter von EeroQ, erklärte den zugrunde liegenden Mechanismus. „Bringt man ein geladenes Teilchen wie ein Elektron in die Nähe der Oberfläche, erzeugt es eine kleine Spiegelladung im flüssigen Helium, da Helium ein Dielektrikum ist“, so Pollanen. Diese schwache positive Ladung bindet das Elektron an die Oberfläche.
Ein entscheidender Vorteil dabei ist, dass Helium chemisch völlig inert ist. Es gibt keine freien Plätze, die ein Elektron besetzen könnte. Daher kann das Elektron nicht in die Flüssigkeit eindringen und bleibt in einem winzigen Abstand darüber gefangen.
Warum flüssiges Helium?
Um Helium zu verflüssigen, sind extrem niedrige Temperaturen erforderlich, die bei etwa 4 Kelvin (-269 Grad Celsius) liegen. Diese Temperatur ist zwar sehr kalt, aber deutlich wärmer und einfacher zu erreichen als die Millikelvin-Bereiche, die für supraleitende Qubits (Transmons) benötigt werden. Ein Nebeneffekt dieser Kälte ist ein nahezu perfektes Vakuum, da fast alle anderen Gase an den Wänden des Behälters kondensieren.
Vom Speicherbecken zur einzelnen Falle
Für ihre Experimente nutzten die Forscher von EeroQ speziell präparierte Siliziumchips. Flüssiges Helium, das bei diesen Temperaturen zu einer sogenannten Superflüssigkeit wird und ohne jegliche Reibung fließt, wird durch winzige Kanäle auf die Chipoberfläche geleitet.
Der Prozess zur Isolation eines einzelnen Elektrons ist mehrstufig:
- Laden: Ein Wolframfaden neben dem Chip wird erhitzt, um Elektronen freizusetzen. Diese sammeln sich auf der Heliumoberfläche in einer Art „Speicherbecken“.
- Einfangen: Auf dem Chip befinden sich einzelne Vorrichtungen, unter denen eine supraleitende Platte liegt. Mit dieser Platte wird eine elektromagnetische Falle erzeugt, die Elektronen an einem bestimmten Ort festhält.
- Befüllen und Leeren: Durch Absenken der „Wände“ dieser Falle können Elektronen aus dem Speicherbecken hineinfließen. Anschließend werden die Wände langsam wieder abgesenkt, sodass die Elektronen kontrolliert entweichen können.
Auf diese Weise gelang es dem Team, die Anzahl der gefangenen Elektronen schrittweise zu reduzieren, bis nur noch ein einziges Elektron in der Falle verblieb. Die Wände der Falle werden dann wieder angehoben, um das Elektron dauerhaft zu isolieren.
Nachweis des einzelnen Elektrons
Um zu überprüfen, ob sich tatsächlich nur ein Elektron in der Falle befindet, setzten die Forscher eine ausgeklügelte Messmethode ein. Zwei Elektroden an den Seiten der Falle bilden einen Resonator. Die Anwesenheit eines Elektrons verändert die Resonanzfrequenz dieses Systems. Durch die präzise Messung dieser Frequenz können die Wissenschaftler eindeutig zwischen null, einem oder zwei Elektronen unterscheiden.
Die in der Fachzeitschrift Physical Review X veröffentlichte Arbeit endet mit diesem Erfolg: der stabilen Isolation eines einzelnen Elektrons. Dies legt den Grundstein für die Entwicklung eines funktionierenden Qubits.
Der Weg zum skalierbaren Quantencomputer
Ein gefangenes Elektron allein ist noch kein Qubit. Der Plan von EeroQ sieht vor, die Information im Spin des Elektrons zu speichern – einer quantenmechanischen Eigenschaft, die man sich vereinfacht als Eigendrehimpuls vorstellen kann. Dieser Ansatz wurde bereits bei anderen Technologien wie Quantenpunkten erprobt.
„Die Spin-Kohärenz des Elektrons wird fantastisch sein“, prognostiziert Pollanen. „Obwohl es noch niemand experimentell gemessen hat, kann sie nicht schlechter sein als bei Elektronen in Silizium.“
Der Grund für diesen Optimismus liegt in der extrem sauberen Umgebung. Das Elektron schwebt isoliert zwischen dem Vakuum und dem inerten Helium, ohne die störenden Wechselwirkungen, die in einem Festkörperkristall auftreten.
Vorteile der Helium-Elektronen-Architektur
- Hohe Kohärenz: Die Isolation des Elektrons verspricht eine lange Lebensdauer des Quantenzustands.
- Standardfertigung: Die Chips können mit bewährter CMOS-Technologie hergestellt werden, was eine schnelle Skalierung auf Millionen von Qubits ermöglichen könnte.
- Integrierte Steuerung: Die gesamte Steuerelektronik kann direkt auf dem Chip integriert werden, was die komplexe Verkabelung zu externen Geräten drastisch reduziert.
- Beweglichkeit: Die Elektronen können auf dem Chip bewegt werden, um Operationen an dedizierten Orten durchzuführen oder Qubits miteinander zu verschränken.
Zwei Elektronen für mehr Stabilität
Langfristig plant EeroQ, ein Qubit nicht in einem einzelnen, sondern in einem Paar von Elektronen mit entgegengesetztem Spin zu kodieren. Dieser Trick soll die Stabilität weiter erhöhen.
„Wenn wir Elektronen bewegen, erfahren sie durch das benötigte Magnetfeld gewisse Inhomogenitäten“, erklärt Pollanen. „Aber wenn man ein Qubit aus zwei Elektronen mit entgegengesetztem Spin bildet, heben sich Störungen, die auf das eine wirken, beim anderen gegenseitig auf.“
Die Fähigkeit, Elektronen zu bewegen, ist ein zentraler Bestandteil des Konzepts. Frühere Arbeiten haben bereits gezeigt, dass ein einzelnes Elektron über eine Gesamtstrecke von mehr als einem Kilometer bewegt werden kann, ohne verloren zu gehen. Diese Mobilität ist entscheidend, um Elektronen für Quantenoperationen zusammenzubringen und sie anschließend wieder zu trennen.
Ob diese Vorteile ausreichen, um die Technologie schnell genug zur Marktreife zu bringen und mit den etablierten Konkurrenten mitzuhalten, bleibt abzuwarten. Die physikalischen Grundlagen sind jedoch vielversprechend und könnten selbst dann ein interessantes Forschungsfeld bleiben, wenn der Weg zum Quantencomputer länger dauert als erhofft.