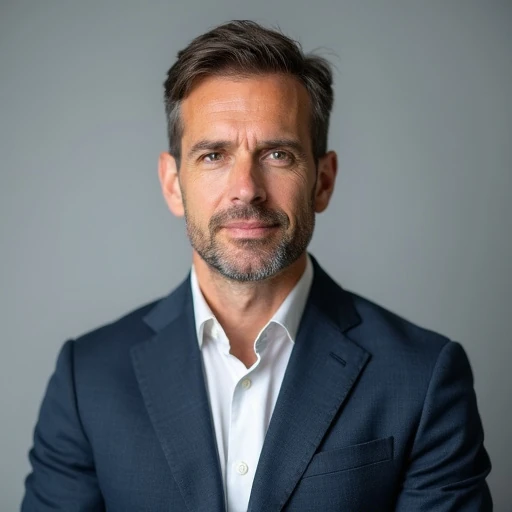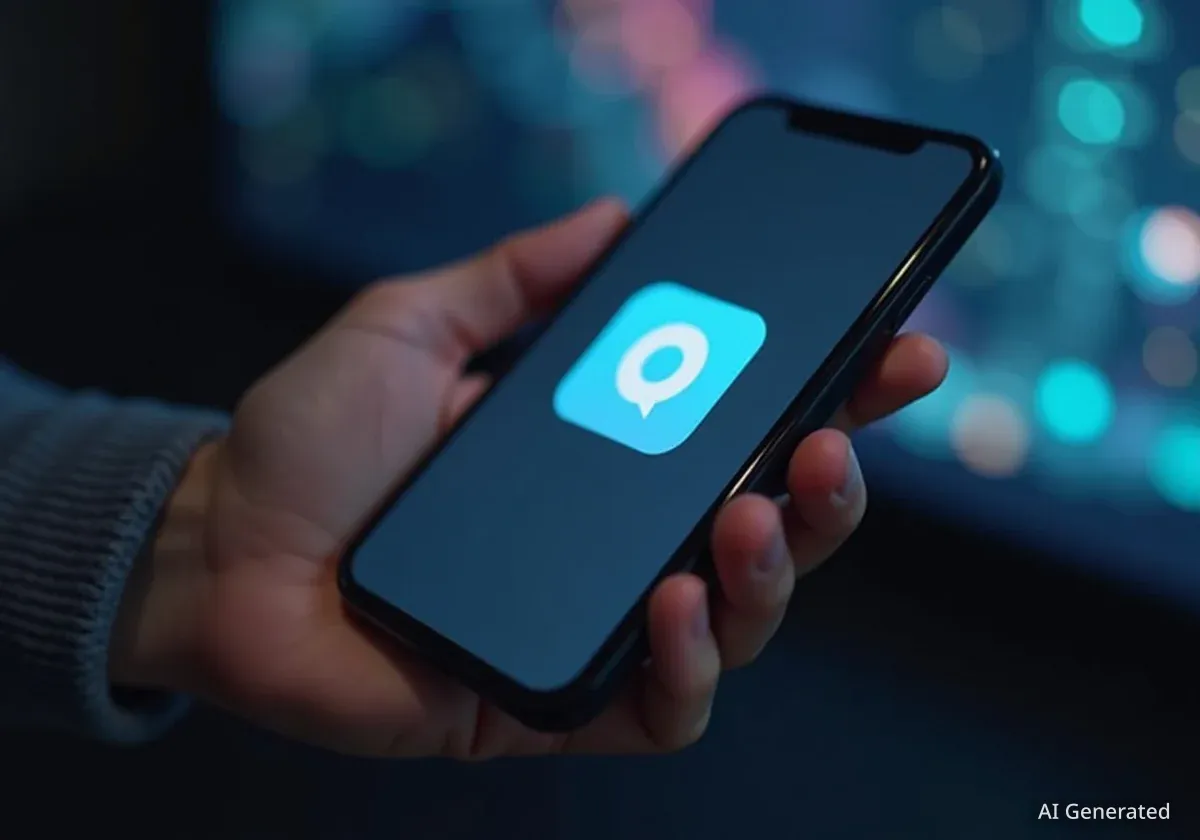Nach der Veröffentlichung der neuen Video-KI-Anwendung Sora von OpenAI ist eine Welle von gefälschten Apps in Apples App Store aufgetaucht. Diese Nachahmer-Anwendungen nutzten den bekannten Namen, um Nutzer zu täuschen und generierten dabei erhebliche Einnahmen, bevor sie teilweise entfernt wurden. Der Vorfall wirft erneut Fragen zur Wirksamkeit von Apples Prüfverfahren auf.
Untersuchungen zeigen, dass mehr als ein Dutzend betrügerischer Apps den Review-Prozess von Apple erfolgreich passierten. Sie sammelten Hunderttausende von Installationen und erzielten Umsätze von über 160.000 US-Dollar, indem sie von der hohen Nachfrage nach der echten Sora-App profitierten.
Wichtige Erkenntnisse
- Über ein Dutzend gefälschter Sora-Apps erschienen nach dem offiziellen Start im App Store.
- Die betrügerischen Apps erzielten zusammen rund 300.000 Installationen.
- Der Gesamtumsatz der Nachahmer-Apps belief sich auf mehr als 160.000 US-Dollar.
- Viele der Apps waren umbenannte, bereits existierende Anwendungen, um von der Popularität von Sora zu profitieren.
- Der Vorfall stellt die Zuverlässigkeit des App-Review-Prozesses von Apple infrage.
Betrüger nutzen Popularität von OpenAI aus
Die Einführung der mit Spannung erwarteten Video-KI Sora von OpenAI, die zunächst nur auf Einladung verfügbar war, schuf eine perfekte Gelegenheit für Betrüger. Kaum war die offizielle Anwendung angekündigt, tauchten im App Store von Apple zahlreiche Fälschungen auf, die sich als „Sora“ oder „Sora 2“ ausgaben. Letzteres war ein direkter Versuch, Nutzer anzusprechen, die nach dem neuesten KI-Modell suchten.
Diese Apps nutzten den markenrechtlich geschützten Namen von OpenAI, der in der Technologiebranche bereits weithin bekannt ist. Trotzdem gelang es den Entwicklern, die internen Kontrollen von Apple zu umgehen und ihre Anwendungen öffentlich zu listen. Dies führte zu erheblicher Verwirrung bei den Nutzern, die auf der Suche nach der legitimen Software waren.
Hintergrund: Die Faszination von Sora
Sora ist ein KI-Modell von OpenAI, das aus einfachen Textbeschreibungen realistische und fantasievolle Videoszenen erstellen kann. Die ersten Demonstrationen sorgten weltweit für Aufsehen und führten zu einer enormen Nachfrage nach der Technologie. Da die offizielle App anfangs nur für eine begrenzte Nutzergruppe zugänglich war, entstand ein Vakuum, das Betrüger schnell füllten.
Analyse der Zahlen: Installationen und Umsätze
Daten der Analyseplattform Appfigures, die auf Anfrage von TechCrunch zur Verfügung gestellt wurden, zeichnen ein klares Bild des Ausmaßes. Über ein Dutzend Apps mit dem Namen „Sora“ wurden nach dem Start der echten Anwendung im App Store live geschaltet. Mehr als die Hälfte davon verwendete den Zusatz „Sora 2“, um moderner zu wirken.
Insgesamt verzeichneten die Nachahmer-Apps auf den Plattformen von Apple und Google rund 300.000 Installationen. Ein signifikanter Teil davon, nämlich mehr als 80.000 Downloads, erfolgte erst nach der Veröffentlichung der offiziellen Sora-App. Zum Vergleich: OpenAI gab bekannt, dass die echte Anwendung inzwischen eine Million Mal heruntergeladen wurde.
Über 160.000 US-Dollar Umsatz
Trotz ihrer oft kurzen Lebensdauer im App Store konnten die gefälschten Anwendungen zusammen mehr als 160.000 US-Dollar an Einnahmen generieren. Dies zeigt, wie profitabel solche Betrugsmaschen sein können, selbst wenn sie nur für wenige Tage oder Wochen aktiv sind.
Die erfolgreichste Fälschung
Die erfolgreichste dieser betrügerischen Apps trug den Namen „Sora 2 – AI Video Generator“. Dieser Titel war offensichtlich darauf ausgelegt, bei Suchanfragen nach „Sora“ ganz oben zu erscheinen. Die Strategie war erfolgreich: Die App wurde nach dem Start der offiziellen Anwendung über 50.000 Mal installiert.
Der bekannte Apple-Blogger John Gruber bezeichnete eine der Fälschungen treffend als den „App Store scam of the week“ (App-Store-Betrug der Woche) und machte damit auf das Problem aufmerksam.
Die Taktik der Umbenennung
Eine genauere Untersuchung der betrügerischen Apps ergab, dass viele von ihnen keine Neuentwicklungen waren. Stattdessen handelte es sich um ältere Anwendungen, die bereits seit Anfang des Jahres oder sogar seit dem Vorjahr im App Store verfügbar waren, oft unter einem völlig anderen Namen.
Die Entwickler aktualisierten diese bestehenden Apps unmittelbar nach der Ankündigung von Sora und änderten lediglich den Namen und das Icon, um auf den Trend aufzuspringen. Diese Methode ermöglicht es, bestehende positive Bewertungen oder eine bereits etablierte Position im Store-Algorithmus auszunutzen, um schneller an Sichtbarkeit zu gewinnen.
Apples Prüfprozess in der Kritik
Der Vorfall wirft ein kritisches Licht auf den App-Review-Prozess von Apple, der eigentlich verhindern soll, dass solche betrügerischen Anwendungen in den Store gelangen. Es bleibt unklar, wie es möglich war, dass Apps, die eindeutig einen bekannten und geschützten Markennamen missbrauchen, die Prüfung bestehen konnten.
Obwohl Apple reagierte und laut Appfigures viele der gefälschten Sora-Apps inzwischen entfernt hat, geschah dies erst, nachdem sie bereits erheblichen Schaden angerichtet und Zehntausende von Nutzern getäuscht hatten. Eine Anfrage an Apple bezüglich der Schwachstellen im Prüfprozess und der verbleibenden Nachahmer-Apps blieb bis zur Veröffentlichung des Originalberichts unbeantwortet.
„Es ist unklar, wie diese Apps an den Prüfern von Apple vorbeikommen konnten“, heißt es in dem Bericht, der die grundlegende Frage nach der Effektivität der Schutzmaßnahmen aufwirft.
Verbleibende Nachahmer im App Store
Auch nach der Säuberungsaktion sind zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch einige Apps mit Bezug zu Sora im App Store zu finden. Diese versuchen, durch geschickte Namensgebung Verwirrung zu stiften, haben aber bisher nur begrenzten Erfolg.
- „PetReels — Sora for Pets“: Diese App hat bisher nur wenige hundert Installationen erreicht.
- „Viral AI Photo Maker: Vi-sora“: Ein Versuch, das Schlüsselwort „Sora“ im Namen zu verstecken, der jedoch kaum Anklang fand.
- „Sora 2 – Video Generator Ai“: Diese Anwendung konnte immerhin mehr als 6.000 Downloads verzeichnen und war weiterhin aktiv.
Diese verbleibenden Beispiele zeigen, dass das Problem nicht vollständig gelöst ist. Nutzer sollten weiterhin wachsam sein und die Herkunft von Anwendungen genau prüfen, insbesondere wenn es sich um neue und stark nachgefragte Technologien handelt.