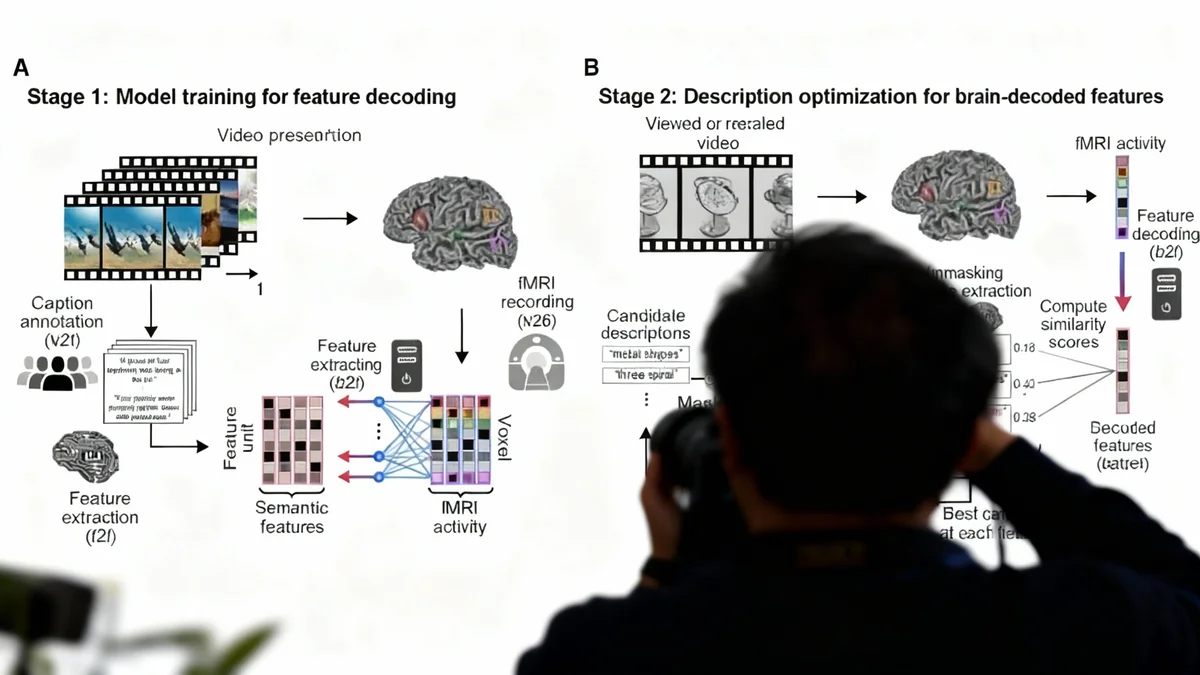Forscher des Massachusetts Institute of Technology (MIT) haben eine grundlegende Entdeckung in der Materialwissenschaft gemacht. Sie stellten fest, dass Metalle selbst nach intensiver Verarbeitung verborgene atomare Ordnungsmuster beibehalten. Diese Erkenntnis widerlegt die jahrzehntelange Annahme, dass Herstellungsprozesse die Atome in Metalllegierungen vollständig zufällig anordnen.
Die Studie, veröffentlicht in Nature Communications, zeigt ein neues physikalisches Phänomen auf, das erklärt, warum diese Muster bestehen bleiben. Die Ergebnisse könnten die Entwicklung von Hochleistungsmaterialien für die Luft- und Raumfahrt, Halbleiterindustrie und Kernreaktoren maßgeblich beeinflussen.
Wichtige Erkenntnisse
- Metalllegierungen erreichen durch Verarbeitung nie einen vollständig zufälligen atomaren Zustand.
- Ein bisher unbekanntes physikalisches Phänomen erklärt, wie atomare Ordnungsmuster erhalten bleiben.
- Sogenannte Versetzungen, Defekte im Metallgitter, erzeugen bei der Verarbeitung neue, nicht-zufällige Muster.
- Die Entdeckung ermöglicht es, Metalle mit gezielt eingestellten Eigenschaften wie Festigkeit und Hitzebeständigkeit zu entwickeln.
Eine jahrzehntelange Annahme widerlegt
In der Materialwissenschaft war man lange davon überzeugt, dass die subtilen chemischen Muster in Metalllegierungen, bekannt als Kurzstreckenordnung, bei der Herstellung verschwinden. Man ging davon aus, dass intensive Prozesse wie Walzen oder Erhitzen die Atome so stark durchmischen, dass eine völlig zufällige Verteilung entsteht.
Neuere Laborstudien deuteten jedoch darauf hin, dass diese Muster einen erheblichen Einfluss auf die Eigenschaften eines Metalls haben können. Dazu gehören mechanische Festigkeit, Hitzekapazität und sogar die Toleranz gegenüber Strahlung.
Das Team am MIT unter der Leitung von Professor Rodrigo Freitas wollte ursprünglich nur untersuchen, wie schnell sich chemische Elemente bei der Verarbeitung vermischen. Ihre Simulationen zeigten jedoch ein unerwartetes Ergebnis.
Simulationen enthüllen eine neue Physik
Mithilfe von maschinellem Lernen verfolgten die Forscher die Bewegungen von Millionen einzelner Atome unter Bedingungen, die typische Herstellungsprozesse nachbilden. „Wir haben ein Stück Metall verformt, was ein üblicher Schritt in der Fertigung ist“, erklärt Freitas. „Die Annahme war, dass dabei die chemischen Bindungen brechen und das System zufällig wird.“
Doch die Simulationen zeigten, dass die Legierungen nie einen vollständig zufälligen Zustand erreichten. Stattdessen blieben bestimmte Muster erhalten und es bildeten sich sogar völlig neue, die außerhalb von Herstellungsprozessen noch nie beobachtet wurden. Dieses Ergebnis deutete auf eine bislang unbekannte physikalische Gesetzmäßigkeit hin.
Was ist Kurzstreckenordnung?
In einer Metalllegierung, die aus verschiedenen Atomarten besteht, bezeichnet die Kurzstreckenordnung die Tendenz von Atomen, sich in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft in bevorzugten Mustern anzuordnen. Anstatt einer zufälligen Mischung bevorzugt beispielsweise ein Atom A, von Atomen des Typs B umgeben zu sein. Diese lokalen Anordnungen beeinflussen die Gesamtstabilität und die physikalischen Eigenschaften des Materials.
Die entscheidende Rolle der Defekte
Um dieses Rätsel zu lösen, entwickelte das Team neue Computermodelle und statistische Methoden. Sie fanden heraus, dass Defekte im Kristallgitter des Metalls, sogenannte Versetzungen, für das Phänomen verantwortlich sind.
Versetzungen sind wie feine Linienfehler, die sich durch das Material bewegen, wenn es verformt wird. Bisher glaubte man, ihre Bewegung würde die atomare Ordnung vollständig zerstören. Die MIT-Studie zeigt jedoch das Gegenteil.
„Diese Defekte haben chemische Präferenzen, die ihre Bewegung steuern“, sagt Freitas. „Sie suchen nach Wegen mit geringer Energie. Wenn sie die Wahl haben, verschiedene chemische Bindungen zu brechen, neigen sie dazu, die schwächsten zu brechen, und das ist nicht völlig zufällig.“
Diese bevorzugte Bewegung führt dazu, dass die Atome nicht zufällig, sondern in neuen, subtilen Mustern neu angeordnet werden. Die Forscher bezeichnen diese Zustände als „fern vom Gleichgewicht“, da sie unter normalen Bedingungen nicht natürlich vorkommen würden.
Ein Zustand wie im menschlichen Körper
Professor Freitas vergleicht den Zustand des Metalls mit dem menschlichen Körper: „Unser Körper befindet sich ebenfalls nicht im Gleichgewicht mit seiner Umgebung. Wir halten einen stabilen Zustand aufrecht, um zu überleben. Ähnlich verhält es sich mit diesen Zuständen im Metall: Sie entstehen aus dem Gleichgewicht zwischen einem inneren Drang zur Unordnung und der ordnenden Tendenz der Versetzungen.“
Von der Grundlagenforschung zur praktischen Anwendung
Auf Basis ihrer Erkenntnisse erstellten die Forscher ein einfaches Modell, das die Entstehung der chemischen Muster vorhersagen kann. Dieses Modell könnte Ingenieuren als Werkzeug dienen, um die Eigenschaften von Metallen gezielt zu steuern.
Durch die Kontrolle der Verarbeitungsschritte könnten Materialien mit maßgeschneiderten Eigenschaften hergestellt werden. Die potenziellen Anwendungsbereiche sind vielfältig:
- Luft- und Raumfahrt: Entwicklung leichterer und gleichzeitig stabilerer Legierungen.
- Halbleiterindustrie: Optimierung von Materialien für elektronische Bauteile.
- Kernreaktoren: Herstellung von Materialien mit höherer Strahlungstoleranz und Langlebigkeit.
- Katalyse: Die atomare Anordnung an der Metalloberfläche ist entscheidend für chemische Reaktionen.
Ein neues Paradigma für die Materialentwicklung
Die Forschungsergebnisse stellen einen Paradigmenwechsel dar. Bisher wurde die chemische Ordnung in Metallen als akademisches Thema betrachtet, das in der industriellen Fertigung kaum eine Rolle spielt. Die Arbeit des MIT-Teams zeigt nun, dass sie ein entscheidender Faktor ist, der gezielt genutzt werden kann.
„Die Schlussfolgerung ist: Man kann die Atome in einem Metall niemals vollständig randomisieren“, betont Freitas. „Dies ist die erste Arbeit, die diese Nicht-Gleichgewichtszustände zeigt, die im Metall erhalten bleiben. Im Moment ist diese chemische Ordnung etwas, das wir bei der Herstellung von Metallen weder kontrollieren noch beachten.“
Mit der neuen Erkenntnis und den entwickelten Modellen hoffen die Forscher, dass Ingenieure diese atomaren Muster zukünftig als Stellschrauben im Designprozess betrachten. Dies könnte zu einer neuen Generation von Materialien führen, die für spezifische und anspruchsvolle Anwendungen optimiert sind.