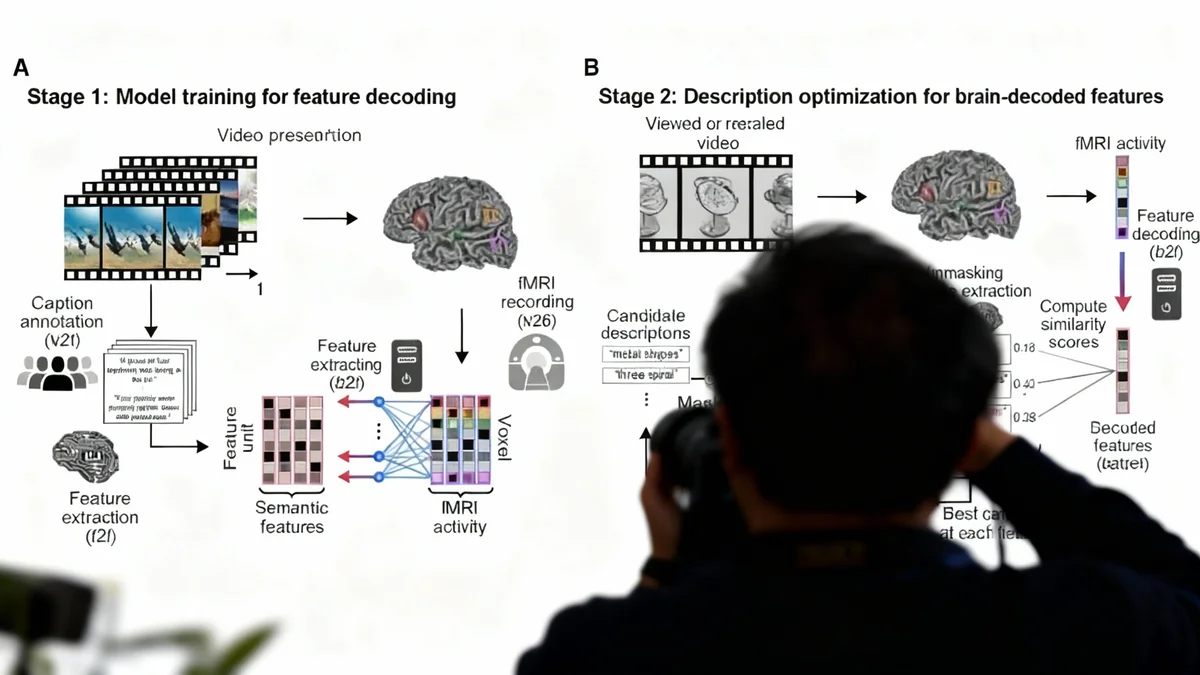Forscher des Massachusetts Institute of Technology (MIT) haben einen entscheidenden Fortschritt bei der Entwicklung eines energiespeichernden Betons erzielt. Das Material, bekannt als ec³, kann nun die zehnfache Energiemenge im Vergleich zu früheren Versionen speichern und rückt die Vision von Gebäuden, die als Batterien fungieren, näher an die Realität.
Die Optimierung des Materials reduziert das benötigte Volumen für die Energieversorgung eines durchschnittlichen Haushalts von 45 Kubikmetern auf etwa 5 Kubikmeter. Dieser Durchbruch könnte die Speicherung erneuerbarer Energien revolutionieren und die Abhängigkeit von traditionellen Batterien verringern.
Wichtige Erkenntnisse
- Die Speicherkapazität des ec³-Betons wurde um das Zehnfache erhöht.
- Statt 45 Kubikmetern werden nur noch 5 Kubikmeter benötigt, um ein Haus einen Tag lang mit Strom zu versorgen.
- Das Material besteht aus Zement, Wasser, Ruß und Elektrolyten.
- Neue Anwendungen reichen von selbstaufladenden Straßen für Elektroautos bis hin zu autarken Gebäuden.
- Der Beton kann auch zur Zustandsüberwachung von Bauwerken eingesetzt werden.
Ein neues Material für die Energiewende
Beton ist das weltweit am häufigsten verwendete Baumaterial. Bisher diente er ausschließlich strukturellen Zwecken. Ein Team am MIT hat diesen traditionellen Baustoff neu konzipiert und ihm eine zusätzliche Funktion verliehen: die Energiespeicherung. Das Material trägt den Namen ec³ (electron-conducting carbon concrete) und wird aus einer Mischung von Zement, Wasser, sehr feinem Ruß und Elektrolyten hergestellt.
Die Rußpartikel bilden im Inneren des Betons ein leitfähiges Nanometer-Netzwerk. Dieses Netzwerk ermöglicht es dem Material, elektrische Energie wie ein Superkondensator zu speichern und bei Bedarf wieder abzugeben. Damit könnten alltägliche Strukturen wie Wände, Fundamente oder Gehwege zu riesigen Energiespeichern werden.
Admir Masic, Hauptautor der neuen Studie und Co-Direktor des EC³ Hub am MIT, erklärt die Vision dahinter: „Ein Schlüssel zur Nachhaltigkeit von Beton ist die Entwicklung von ‚multifunktionalem Beton‘, der Funktionen wie Energiespeicherung, Selbstheilung und Kohlenstoffbindung integriert.“
Zehnfache Kapazität durch verbesserte Zusammensetzung
Die jüngste Veröffentlichung in der Fachzeitschrift PNAS beschreibt eine signifikante Steigerung der Energiedichte des ec³-Materials. Während die Version aus dem Jahr 2023 noch 45 Kubikmeter Beton benötigte, um den Tagesbedarf eines durchschnittlichen Haushalts zu decken, schafft die neue Variante dies mit nur noch etwa 5 Kubikmetern. Dies entspricht dem Volumen einer typischen Kellerwand.
Leistungssteigerung im Detail
Ein Kubikmeter des optimierten ec³-Betons kann nun über 2 Kilowattstunden (kWh) Energie speichern. Das ist genug, um einen herkömmlichen Kühlschrank für einen ganzen Tag zu betreiben.
Dieser Fortschritt wurde durch ein tieferes Verständnis der inneren Struktur des Materials möglich. Die Forscher nutzten eine fortschrittliche Bildgebungstechnik (FIB-SEM-Tomographie), um das leitfähige Netzwerk aus Rußpartikeln in 3D zu rekonstruieren. Dabei entdeckten sie, dass das Netzwerk eine fraktalähnliche Struktur bildet, die die Poren im Beton umschließt. Diese Struktur ist entscheidend für den Ionenfluss und die Stromleitung.
Optimierte Elektrolyte und Herstellung
Mit diesem Wissen experimentierte das Team mit verschiedenen Elektrolyten, um die Speicherdichte zu maximieren. „Wir haben festgestellt, dass eine breite Palette von Elektrolyten für ec³ in Frage kommt. Dazu gehört sogar Meerwasser“, sagt Damian Stefaniuk, Erstautor der Studie. Dies eröffnet Möglichkeiten für den Einsatz in Küstenregionen oder bei Offshore-Windkraftanlagen.
Gleichzeitig wurde der Herstellungsprozess vereinfacht. Anstatt den ausgehärteten Beton in Elektrolyt zu tränken, wird dieser nun direkt dem Anmischwasser beigefügt. Dies ermöglicht die Herstellung dickerer Elektroden, die mehr Energie speichern können.
Die besten Ergebnisse erzielten die Forscher mit organischen Elektrolyten. Eine Kombination aus quartären Ammoniumsalzen, die auch in Desinfektionsmitteln vorkommen, und dem leitfähigen Lösungsmittel Acetonitril erwies sich als besonders leistungsfähig.
Praktische Anwendungen und zukünftige Visionen
Obwohl herkömmliche Batterien eine höhere Energiedichte aufweisen, hat ec³ entscheidende Vorteile. Das Material kann direkt in die Bausubstanz integriert werden und hat eine Lebensdauer, die der des Gebäudes selbst entspricht. Es sind keine seltenen oder umweltschädlichen Materialien wie Lithium oder Kobalt erforderlich.
„Die Antwort ist, dass man eine Möglichkeit zum Speichern und Freisetzen von Energie braucht. Wir glauben, dass ec³ ein praktikabler Ersatz ist, der es unseren Gebäuden und unserer Infrastruktur ermöglicht, unseren Energiespeicherbedarf zu decken.“
Die Forscher sehen vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Franz-Josef Ulm, Co-Direktor des EC³ Hub, betont die Rolle des Materials bei der Energiewende: „Solarenergie kann nur bei ausreichendem Sonnenschein Strom erzeugen. Die Frage ist also: Wie deckt man seinen Energiebedarf nachts oder an bewölkten Tagen?“
Inspiration aus der Antike
Das Team ließ sich von der römischen Architektur inspirieren, die massive Betonbauten wie das Pantheon ohne Stahlbewehrung errichtete. „Wenn wir diesen Geist der Kombination von Materialwissenschaft und architektonischer Vision beibehalten, könnten wir am Rande einer neuen architektonischen Revolution mit multifunktionalen Betonen wie ec³ stehen“, so Admir Masic.
Ein Beton, der seinen Zustand überwacht
Um die Doppelfunktionalität zu demonstrieren, baute das Team einen kleinen Bogen aus ec³-Beton. Der Bogen konnte sein eigenes Gewicht tragen und gleichzeitig eine LED-Leuchte mit 9 Volt Spannung versorgen. Dabei machten die Wissenschaftler eine unerwartete Entdeckung: Als die Last auf den Bogen erhöht wurde, begann die LED zu flackern.
Dieser Effekt entsteht vermutlich, weil die mechanische Spannung die elektrischen Kontakte oder die Ladungsverteilung im Material beeinflusst. Diese Eigenschaft könnte für eine Art Selbstüberwachung von Bauwerken genutzt werden.
„Wenn wir an einen ec³-Bogen in architektonischem Maßstab denken, könnte seine Leistung schwanken, wenn er durch einen Stressfaktor wie starke Winde beeinflusst wird“, erklärt Masic. „Wir könnten dies als Signal nutzen, wann und in welchem Ausmaß eine Struktur belastet ist, oder ihre allgemeine Gesundheit in Echtzeit überwachen.“
Der Weg zur Marktreife
Die Technologie ist bereits über das Laborstadium hinaus. In Sapporo, Japan, wurde ec³ aufgrund seiner Wärmeleitfähigkeit zur Beheizung von Gehwegen eingesetzt, als Alternative zum Streusalz. Die neuen Entwicklungen bringen das Material einen großen Schritt näher an die breite Anwendung.
Zu den Zukunftsvisionen gehören:
- Parkplätze und Straßen, die Elektrofahrzeuge während des Parkens oder Fahrens aufladen.
- Wohnhäuser, die ihren eigenen Strom speichern und vollständig netzunabhängig betrieben werden können.
- Fundamente für Windkraftanlagen, die gleichzeitig als Energiespeicher dienen.
„Was uns am meisten begeistert, ist, dass wir ein so altes Material wie Beton genommen und gezeigt haben, dass es etwas völlig Neues leisten kann“, fasst James Weaver, Mitautor der Studie, zusammen. Die Kombination aus moderner Nanowissenschaft und einem antiken Baustoff könnte die Art und Weise, wie wir unsere Infrastruktur bauen und mit Energie versorgen, grundlegend verändern.